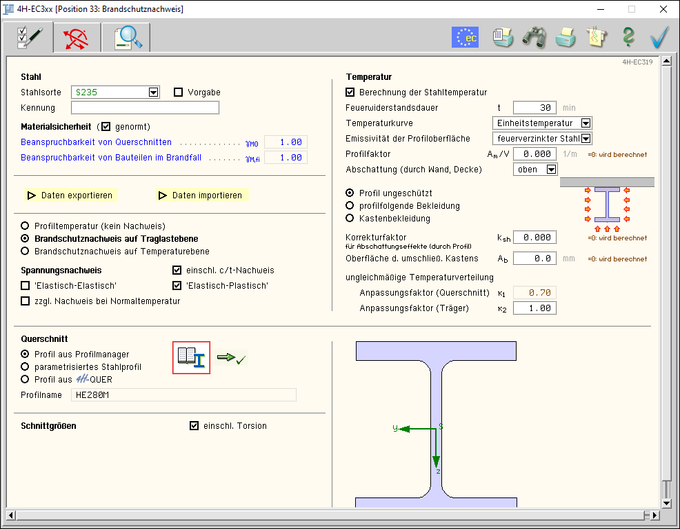|
|
| Seite überarbeitet Januar 2024 |
 |
Kontakt |
 |
|
 |
Programmübersicht |
 |
|
 |
Bestelltext |
 |
|
|
| Infos auf dieser Seite |
... als pdf |
 |
|
 |
 |
Eingabeoberfläche ................. |
 |
|
|
|
 |
Berechnungseinstellungen ..... |
 |
|
 |
Ergebnisübersicht .................. |
 |
|
 |
Bemessungsverfahren ............ |
 |
|
 |
Schnittgrößen ....................... |
 |
|
 |
Temperaturberechnung .......... |
 |
|
 |
Spannungsnachweise ............ |
 |
|
 |
Schnittgrößenimport .............. |
 |
|
 |
Mech. Werkstoffeigenschaften |
 |
|
 |
Beschreibung Ergebnisse ....... |
 |
|
|
|
|
 |
|
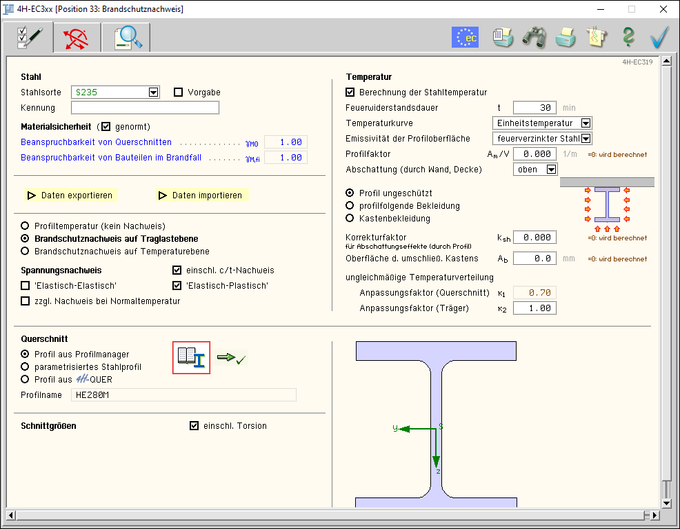 |
|
| Bild vergrößern |
 |
|
|
|
 |
| Brandschutznachweise
EC 3 |
Das Programm 4H-EC3BN
führt den Brandschutznachweis
für beliebige Querschnitte unter
zweiachsiger
Belastung nach Eurocode 3-1-2. |
|
|
|
Die zugehörigen Eingabeparameter werden
in eigenen Registerblättern verwaltet, die über folgende
Symbole
die dahinter liegende Parameterauswahl kenntlich machen. |
|
 |
|
 |
| Im ersten Registerblatt werden die
wesentlichen Parameter zum Ablauf der Berechnung
festgelegt. |
Dazu gehören die Materialangaben,
die Materialsicherheitsbeiwerte, die Querschnittsgeometrie.
Weiterhin können die zu führenden
Nachweise ausgewählt werden. |
| Der Querschnitt wird zur Info maßstäblich am Bildschirm
dargestellt. |
|
|
|
 |
|
 |
Die Schnittgrößen werden
im zweiten Registerblatt festgelegt und können entweder 'per Hand'
eingegeben oder aus einem 4H-Stabwerksprogramm importiert werden. |
|
|
|
 |
|
 |
Im dritten Registerblatt werden
die Ergebnisse (Ausnutzungen) lastfallweise und detailliert
im Überblick dargestellt. |
|
|
|
|
 |
|
 |
| Weiterhin ist zur vollständigen
Beschreibung der Berechnungsparameter der dem Eurocode
zuzuordnende nationale Anhang zu wählen. |
| Über den NA-Button wird das entsprechende Eigenschaftsblatt aufgerufen. |
|
|
|
 |
|
 |
| Im Eigenschaftsblatt, das nach Betätigen
des Druckeinstellungs-Buttons
erscheint, wird der Ausgabeumfang der Druckliste
festgelegt. |
|
|
|
 |
|
 |
Das Statikdokument kann durch Betätigen
des Visualisierungs-Buttons
am Bildschirm
eingesehen werden. |
|
|
|
 |
|
 |
| Über den Drucker-Button
wird in das Druckmenü gewechselt,
um das Dokument auszudrucken. |
| Hier werden auch die Einstellungen
für die Visualisierung vorgenommen. |
|
|
|
 |
|
 |
| Über den Pläne-Button
wird das pcae-Programm zur Planbearbeitung aufgerufen. |
Der aktuelle Querschnitt wird im pcae-Planerstellungsmodul
dargestellt, kann dort
weiterbearbeitet, geplottet
oder im DXF-Format exportiert werden. |
|
|
|
 |
|
 |
| Über den Hilfe-Button
wird die kontextsensitive Hilfe zu den einzelnen
Registerblättern aufgerufen. |
|
|
|
 |
|
 |
| Das Programm kann mit oder ohne Datensicherung
verlassen werden. |
| Bei Speichern der Daten wird die
Druckliste aktualisiert und in das globale Druckdokument
eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
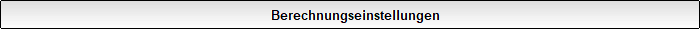 |
|
 |
im Register 1 werden die
allgemeinen
Einstellungen der Berechnung festgelegt. |
|
|
| Material |
 |
|
|
| Der Querschnitt besteht aus Stahl. |
|
|
|
Da die Beschreibung der Stahlparameter für eine
Berechnung nach EC 3 programmübergreifend identisch ist,
wird auf die
allgemeine Beschreibung der Stahlsorten verwiesen. |
|
|
| Materialsicherheitsbeiwerte |
 |
|
| Für den Spannungsnachweis n. EC 3-1-1 wird
folgender Materialsicherheitsbeiwert verwendet |
|
|
|
Die Werte können entweder den entsprechenden Normen
(s. Nationaler Anhang) entnommen oder
vom Anwender vorgegeben werden. |
|
|
| Allgemeines |
 |
|
|
Im Programm 4H-EC3BN
besteht die Möglichkeit, die Eingabedaten über die
Copy-Paste-Funktion von einem
Bauteil in ein anderes desselben
Typs zu exportieren. |
|
|
|
Dazu ist der
aktuelle Datenzustand im abgebenden Bauteil über den Button Daten exportieren in
die
Zwischenablage zu kopieren und anschließend über den Button Daten
importieren aus der Zwischenablage
in das aktuell geöffnete andere Bauteil zu übernehmen. |
|
|
| Querschnitt |
 |
|
|
|
|
| Spannungsnachweis |
 |
|
Für den Brandschutznachweis ist
ein Spannungsnachweis des Querschnitts erforderlich, wobei die
Materialparameter der Brandsituation angepasst sind. |
| Optional können ein elastischer und plastischer Nachweis
in einem Rechengang geführt
werden. |
| Die Beschreibung der Spannungsnachweise erfolgt hier. |
|
| Bedingung für die Gültigkeit der Verfahren
ist, dass der Querschnitt nicht beulgefährdet ist. Ein
vereinfachter Beulnachweis wird über das c/t-Verhältnis erbracht. Ein entsprechender Nachweis kann aktiviert/deaktiviert
werden. |
Zusätzlich können Spannungs- und c/t-Nachweis
auch bei Normaltemperatur geführt werden. Die Schnittgrößen
bei Normaltemperatur werden vereinfacht über den Lastfaktor
(s. EC3-1-2, 2.4.2(2)) aus den Schnittgrößen im
Brandfall berechnet. |
|
|
| Brandschutz |
 |
|
|
| Allgemeines |
 |
|
| Brandbedingte Einwirkungen werden als außergewöhnliche
Einwirkungen betrachtet, s. EC 1-1-2, 2.1(3)P u. 4.2.1(2). |
| Der Nachweis der Tragfähigkeit sollte n. EC 1-1-2, 2.5(2) erfolgen im |
|
| Wenn indirekte Brandeinwirkungen nicht ausdrücklich zu
berücksichtigen sind, dürfen die Einwirkungen im Brandfall
vereinfacht aus den Einwirkungen bei Normaltemperatur ermittelt
werden (s. EC 1-1-2, 4.3.2(2) und EC 3-1-2, 2.4.2(2)). |
|
Vereinfacht darf der Abminderungsfaktor zu ηfi = 0.65
bzw. bei Lasten der Kategorie E zu ηfi = 0.7 gesetzt werden
(s.
EC 3-1-2, 2.4.2(2), Anmerkung 2). |
|
| Temperatur |
 |
|
| Bei dünnwandigen Profilen wird davon ausgegangen,
dass die thermische Beanspruchung durch den Brand eine gleichmäßige
Temperatur im Material erzeugt. |
| Die Festigkeit des Stahls wird dadurch z.T. stark
herabgesetzt, sodass durch einen Spannungsnachweis die Standfestigkeit
nach einer Mindestzeit (Feuerwiderstandsdauer) nachgewiesen
werden muss. |
| Die drei Temperaturkurven des EC 1-1-2,
3.2 können angewählt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, die Emissivität (Absorbitivität) der Bauteiloberfläche anzugeben, die von der Materialbeschaffenheit der Profiloberfläche abhängt. Bei Baustahl wird eine Emissivität von εm = 0.7 verwendet (EC3-1-2,2.2(2)). |
Die Berechnung der Stahltemperatur erfolgt nach
EC 1-1-2 unter Berücksichtigung des Profilfaktors (Formfaktor
des Querschnitts) sowie einer ggf. vorhandenen
Profilummantelung. |
| Es werden Eingabefelder für die erforderlichen
Werte angeboten. Sind sie nicht belegt, kann das Programm
diese Werte berechnen. Voraussetzung ist, dass es sich
um ein typisiertes Profil handelt (nicht 4H-QUER-Querschnitt). |
|
| Bei ungeschützten Profilen entwickelt sich
die Temperatur abhängig von der Oberflächen-Absorbitivität
(Emissivität).
Programmintern wird sie für 'Stahl' und 'feuerverzinkten
Stahl' vorbelegt. Alternativ kann ein Wert vorgegeben werden. |
|
| Das Profil kann durch angrenzende Bauteile teilweise
vor der Hitze geschützt sein. Diese Abschattungseffekte
durch eine Wand oder aufliegende Deckenplatte können berücksichtigt
werden. Sie werden grafisch verdeutlicht. |
|
| Ist das Profil ungeschützt, werden die Abschattungseffekte
durch das Profil selbst über einen Korrekturfaktor berücksichtigt.
Der entsprechende Beiwert kann vorgegeben oder vom Programm
berechnet werden. |
|
Andernfalls sind die Materialparameter der Bekleidung
vorzugeben. Im deutschen Anhang des EC 3-1-2,
Anhang AA, sind
Werte für Putz- und Plattenbekleidung dokumentiert, die
hier angewählt werden können. |
|
| Alternativ können die Parameter frei
belegt und ein Name
vergeben werden kann. |
| Feuchtigkeit und Dicke des Dämmmaterials sind
ebenfalls anzugeben. |
|
| Beim Brandschutznachweis wird eine gleichmäßige
Temperaturverteilung sowohl über den Querschnitt als auch in
Stablängsrichtung angenommen. Um z.B. Temperaturdifferenzen
durch Abschattung (Querschnitt) oder an Auflagern (Träger)
auszugleichen, kann die Brandlast durch Anpassungsfaktoren
abgemindert werden. Liegt ein typisierter Querschnitt vor,
wird der Beiwert vom Programm gesetzt, andernfalls ist er
vorzugeben. |
|
|
| Nachweis |
 |
|
| Der Brandschutznachweis kann auf Traglast- oder
Temperaturebene geführt werden. |
Der Traglastnachweis wird über einen elastischen oder plastischen
Spannungsnachweis geführt. Beim Temperaturnachweis ist die
vorhandene Temperatur einer kritischen Temperatur gegenüber
zu stellen,
die entweder vom Programm berechnet oder
vorgegeben werden kann. |
|
| Da die kritische Temperatur abhängig von der Belastung ist,
wird auch hier die Spannungsausnutzung nach dem elastischen
oder plastischen Verfahren berechnet. |
| Alternativ kann nur die Profiltemperatur
ermittelt werden. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
das zweite Register beinhaltet die
Masken zur Eingabe der Bemessungsschnittgrößen im Brandfall |
|
Die Schnittgrößen werden als Bemessungsgrößen
mit der Vorzeichendefinition
der Statik eingegeben, wobei das x,y,z-Koordinatensystem dem l,m,n-System
der pcae-Tragwerksprogramme entspricht. |
| Es können bis zu 10.000 Schnittgrößenkombinationen eingegeben werden. |
|
 |
Bei
Übernahme der Schnittgrößen aus einem Tragwerksprogramm ist
zu beachten, dass sie sich auch bei unsymmetrischen Querschnitts-profilen (z.B. L-Profil) auf das
Stab-Koordinatensystem
und nicht auf
das Hauptachsensystem (pcae-Bezeichnung: ξ,η,ζ) beziehen! |
|
|
|
|
|
|
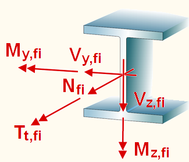 |
|
| Die Schnittgrößen können wahlweise in folgenden Einheiten
vorliegen |
|
|
|
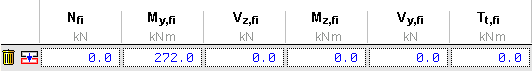 |
|
| Im Standardfall |
|
 |
| bewirken die Schnittgrößenkombinationen
Nfi, My,fi, Vz,fi eine Biegung um die starke
Achse des Querschnitts |
|
 |
| bewirken die Schnittgrößenkombinationen
Nfi, Mz,fi, Vy,fi eine Biegung um die schwache
Achse des Querschnitts |
|
 |
| ist das Torsionsmoment Tt,fi (St.Venant'sche
bzw. primäre Torsion) nur für Hohl- und Vollquerschnitte
relevant |
|
|
|
| Sind Torsionsschnittgrößen für den
betrachteten Querschnitt nicht maßgebend und sollen nicht untersucht
werden, kann die entsprechende Schnittgrößenspalte deaktiviert
werden, indem in Register 1 die
entsprechende Option abgewählt wird. |
| Die Zahlenwerte in der Spalte sind grau dargestellt,
können jedoch weiter bearbeitet werden. Bei der Bemessung werden
diese Schnittgrößen ignoriert. |
|
|
|
|
 |
|
| Die statische Berechnung eines Bauteils beinhaltet
i.A. die Modellbildung mit anschließender Berechnung
des Tragsystems sowie nachfolgender Einzelnachweise
von Detailpunkten. |
| Bei der Beschreibung eines Details sind die zugehörenden
Schnittgrößen aus den Berechnungsergebnissen des Tragsystems zu extrahieren
und
dem Detailnachweis zuzuführen. |
|
| In der 4H-Programmorganisation gibt es hierzu verschiedene
Vorgehensweisen |
 |
zum einen können Tragwerks- und Detailprogramm
fest miteinander verbunden sein, d.h. die Schnittgrößenüber-
gabe
erfolgt intern. Es sind i.A. keine weiteren Eingaben
(z.B. Geometrie) notwendig, aber auch möglich (z.B.
weitere Belastungen), die Programme bilden eine Einheit. |
| Dies ist z.B. bei dem 4H-Programm Stütze
mit Fundament der Fall. |
|
 |
| zum anderen können Detailprogramme Schnittgrößen von in Tragwerksprogrammen speziell festgelegten Exportpunkten über ein zwischengeschaltetes Export/Import-Tool einlesen |
| Das folgende Beispiel eines einfachen Rahmens erläutert diesen 4H-Schnittgrößen-Export/Import. |
|
|
|
Zunächst sind im exportierenden 4H-Programm
(z.B. 4H-FRAP) die Stellen
zu kennzeichnen, deren Schnittgrößen
beim nächsten Rechenlauf exportiert,
d.h.
für
den Import bereitgestellt, werden sollen. |
|
| In diesem Beispiel sollen die Schnittgrößen
für den Brandschutznachweis übergeben werden. |
Dazu
ist an der entsprechenden Stelle ein Kontroll-
punkt zu setzen. |
|
Ausführliche Informationen zum Export entnehmen
Sie
bitte dem DTE®-Schnittgrößenexport. |
|
| Es ist ein Nachweis mit einer
außergewöhnlichen
Einwirkungskombination (Brandfall) zu definieren. |
| Nach einer Neuberechnung des Rahmens stehen
die Exportschnittgrößen
dem aufnehmenden 4H-Programm (z.B. 4H-EC3BN)
zum Import zur Verfügung. |
|
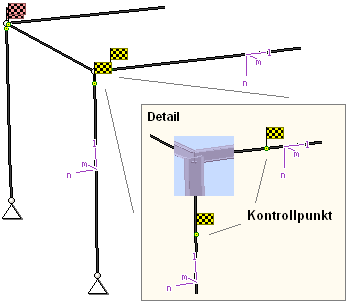 |
|
|
 |
aus dem aufnehmenden 4H-Programm
wird nun über den Import-Button das
Fenster zur
DTE®-Bauteilauswahl aufgerufen.
Hier werden alle berechneten Bauteile dargestellt, wobei diejenigen,
die Schnittgrößen
exportiert haben, dunkel gekennzeichnet sind. |
|
|
Das gewünschte Bauteil kann nun markiert und über
den bestätigen-Button ausgewählt
werden. Alternativ kann
durch Doppelklicken des Bauteils direkt in die DTE®-Schnittgrößenauswahl verzweigt
werden. |
|
 |
|
In der Schnittgrößenauswahl werden die verfügbaren
Schnittgrößenkombinationen aller im übergebenden
Programm gekennzeichneten Schnitte angeboten. Dabei sind diejenigen Schnitte
deaktiviert, deren Material nicht kompatibel
mit dem Detailprogramm ist. |
| Es wird nun der Schnitt angeklickt und damit geöffnet, dessen Schnittgrößen
eingelesen werden sollen. |
|
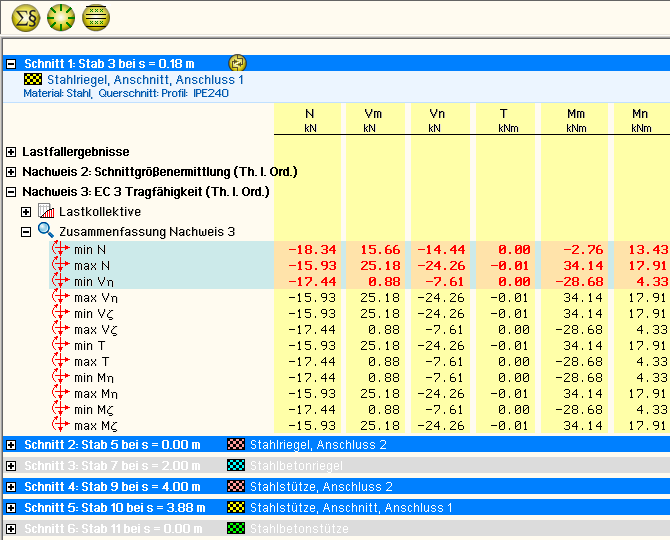 |
|
| Die Schnittgrößenkombinationen können beliebig zusammengestellt
werden; pcae empfiehlt jedoch, nur diejenigen
auszuwählen, die als
Bemessungsgrößen für den zu führenden Detailnachweis
relevant sind. |
|
|
| ein nützliches Hilfsmittel
bietet dabei der dargestellte Button, mit dem die Anzahl zu übertragender Lastkombinationen durch Eliminierung doppelter Zeilen stark reduziert werden kann. |
|
|
|
Wird nun die DTE®-Schnittgrößenauswahl bestätigt,
bestückt das Importprogramm die Schnittgrößentabelle,
wobei ggf. vorhandene Kombinationen erhalten bleiben. |
|
Wenn eine Reihe von Stäben gleichartig ausgeführt und nachgewiesen werden soll, können in einem Rutsch
weitere Schnittgrößen anderer Schnitte aktiviert und so bis zu 10.000 Kombinationen übertragen werden. |
|
|
| Die Kompatibilität der Querschnitts- und Nachweisparameter
zwischen exportierendem und importierendem Programm ist zu gewährleisten. |
|
|
| |
Eine Aktualisierung der importierten Schnittgrößenkombinationen, z.B. aufgrund einer Neuberechnung
des exportierenden Tragwerks, erfolgt nicht! |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
das dritte Register gibt einen Überblick über
die ermittelten Ergebnisse |
|
|
| Zur sofortigen Kontrolle werden die Ergebnisse in diesem Register lastfallweise übersichtlich
zusammengestellt. |
|
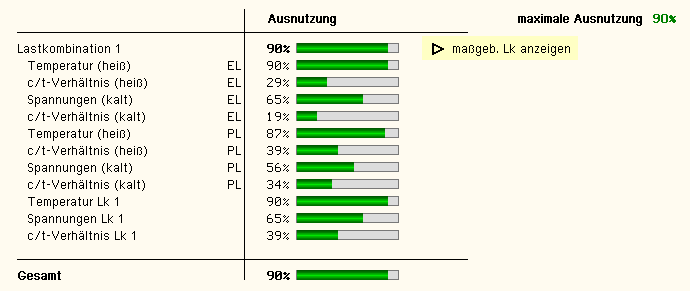 |
|
Eine Box zeigt an, ob eine Lastkombination die Ausnutzung überschritten hat (rot ausgekreuzt)
oder wie viel Reserve noch vorhanden ist (grüner Balken). |
Bei nur wenigen Lastkombinationen werden zur Fehleranalyse
oder zur Einschätzung
der Tragkomponenten
die Einzelberechnungsergebnisse
protokolliert. |
| Sind es mehr, bis zu zehn Lastkombinationen, werden
die wesentlichen Einzelberechnungsergebnisse
protokolliert. |
Die maximale Ausnutzung wird sowohl als 'Gesamt' unterhalb
der Zusammenstellung als auch am oberen
rechten Fensterrand angezeigt. |
Ebenso wird die maßgebende Lastkombination gekennzeichnet
und kann über den Aktionslink direkt in der
Druckliste eingesehen
werden. |
|
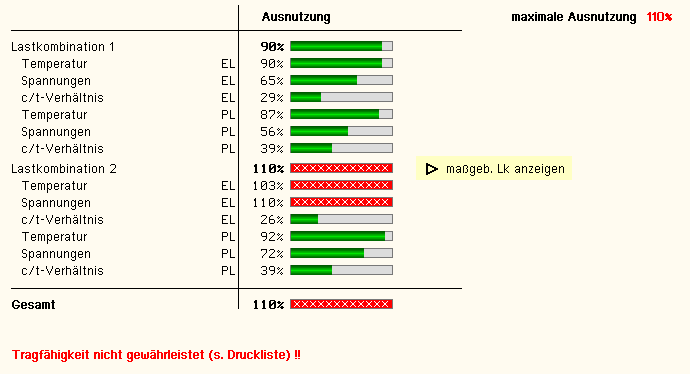 |
|
| Eine Meldung zeigt an, wenn ein Fehler aufgetreten
oder die Ausnutzung überschritten ist. |
| Wenn die Ursache des Fehlers nicht sofort ersichtlich ist, sollte
die Druckliste in der ausführlichen Ergebnisdarstellung geprüft
werden. |
|
|
|
 |
|
| Bei brandbeanspruchten Oberflächen wird der Netto-Wärmestrom,
der von dem Feuer auf die Oberfläche des Bauteils wirkt, ermittelt
mit (s. EC 1-1-2, 3.1) |
|
Der Wärmeübergangskoeffizient für Konvektion richtet sich nach der
verwendeten Temperaturzeitkurve
(s. EC 1-1-2, 3.2). |
Die Emissivität der Bauteiloberfläche
von unbehandeltem Stahl beträgt εm = 0.7 (s.
EC 3-1-2, 2.2(2)).
Eine Feuerverzinkung bewirkt, dass bei Temperaturen
bis 500°C nur 50% der Emissivität (εm =
0.35) vorliegt. |
| Die Emissivität der Flamme
wird
mit εf = 1.0 (s. EC 1-1-2, 3.1(6), Anmerkung 2,
EC 3-1-2, 4.2.5.1(3)) angenommen. |
| Der Konfigurationsfaktor wird n. EC 1-1-2, 3.1(7) gesetzt zu φ = 1.0. |
Die Strahlungstemperatur Θr wird durch die Gastemperatur Θg ausgedrückt, die sich aus den
Temperaturzeitkurven ergeben. |
| Drei nominelle Temperaturzeitkurven sind auswählbar (EC 1-1-2, 3.2) |
|
 |
| Einheits-Temperaturzeitkurve |
|
|
|
|
|
|
| Naturbrandmodelle werden nicht unterstützt. |
| In EC 1-1-2, NA Deutschland ist festgelegt, dass bei Tragwerken
im Hochbau i.d.R. die Einheits-Temperaturzeitkurve anzuwenden
ist. Die Hydrokarbon-Brandkurve ist für Hochbauten nicht anzuwenden. |
Die Normaltemperatur entspricht θ0 = 20°C, die Rohdichte
von Stahl ist ρa = 7850 kg/m3 (temperaturunabhängig,
s. EC 3-1-2, 3.2.2(1)). |
| Nach EC 3-1-2, 4.2.5 wird unterschieden zwischen innen liegenden
und außen liegenden Stahlkonstruktionen. |
| Innen liegende Bauteile können ungeschützt
oder durch Brandschutzmaterial geschützt sein. |
| Bei außen liegenden Konstruktionen sind i.d.R. zu berücksichtigen |
 |
| der Wärmestrom durch Strahlung aus dem Brandabschnitt |
|
 |
| der Wärmestrom durch Strahlung und Konvektion von aus Öffnungen
herausschlagenden Flammen |
|
 |
| der Wärmestrom durch Strahlung und Konvektion der Stahlkonstruktion
an die Umgebung |
|
 |
| die Größe und Lage des Bauteils |
|
|
| Sie werden hier nicht behandelt. |
|
| Innen liegendes ungeschütztes Stahlbauteil
(EC 3-1-2, 4.2.5.1) |
 |
|
| Der Temperaturanstieg Δθa,t berechnet sich
für ein ungeschütztes Profil mit |
|
| Am/V wird als Profilfaktor des ungeschützten Stahlbauteils
bezeichnet und kann für typisierte Profile auch der Fachliteratur
entnommen werden. Er sollte hier nicht kleiner als 10 1/m sein. |
| Der Korrekturfaktor für den Abschattungseffekt durch das Profil
selbst wird bestimmt mit |
|
| Die Schrittweite Δ t sollte 5 sec nicht überschreiten. |
|
|
| Innen liegendes durch Brandschutzmaterialien geschütztes
Stahlbauteil (EC 3-1-2, 4.2.5.2) |
 |
|
| Der Temperaturanstieg Δθa,t berechnet sich
für ein geschütztes Profil mit |
|
| Für die Fläche Ap wird die innere Fläche
des umgebenden Kastens angesetzt. |
| Ap/V wird als Profilfaktor des wärmegedämmten
Stahlbauteils bezeichnet und kann für typisierte Profile
auch der Fachliteratur entnommen werden. |
| Die Schrittweite Δ t sollte 30 sec nicht überschreiten. |
Bei feuchten Brandschutzmaterialien wird der Temperaturanstieg
im Stahl verzögert. Die Zeitverzögerung ergibt
sich für den Feuchtigkeitsanteil p [in %] zu (s. J.-M.
Franssen, P Vila Real: Fire design of steel structures,
2nd Edition,
ECCS 2015) |
|
|
|
|
|
 |
|
Die Spannungs-Dehnungsbeziehung für Stahl
unter erhöhter Temperatur sollte wie folgt angenommen werden
(EC
3-1-2, 3.2.1, Bild 3.1) |
|
| wobei die Festigkeiten des erwärmten Stahls aus denen bei Normaltemperatur
abgeleitet werden. |
|
| mit den Abminderungsbeiwerten (s. EC 3-1-2, 3.2.1, Tab. 3.1) |
|
| Die Dehnungen sind z.T. temperaturunabhängig |
|
| Es wird ein einfaches Berechnungsmodell angewandt,
das für einzelne Bauteile auf der Grundlage konservativer Annahmen
gilt (EC 3-2-1, 4.1). |
| Die thermische Dehnung von Stahl bestimmt sich nach EC 3-1-2, 3.4.1.1, zu |
|
| Der Temperaturausdehnungskoeffizient ergibt sich daraus zu |
|
| Die spezifische Wärmekapazität wird wie folgt ermittelt |
|
| Die Wärmeleitfähigkeit wird berechnet mit |
|
|
|
|
 |
|
Der Bemessungswert der maßgebenden Beanspruchung Efi,d darf die Beanspruchbarkeit des Stahlbauteils Rfi,d,t
zum Zeitpunkt
t nicht überschreiten |
|
| Es wird eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Querschnitt angenommen
(s. EC 3-1-2, 4.2.1(2)). |
| Bei einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung z.B. durch
Abschattung oder an Auflagern kann die Momentenbeanspruchbarkeit
durch Anpassungsfaktoren κ1 und κ2 erhöht werden
(s. EC 3-1-2, 4.2.3.3(3)). |
| Anpassungsfaktor κ1 für eine ungleichmäßige Temperaturverteilung über den Querschnitt |
|
| Anpassungsfaktor κ2 für eine ungleichmäßige Temperaturverteilung über den Träger |
|
| Anstelle der Erhöhung des aufnehmbaren Moments Mfi,Rd wird hier das einwirkende
Moment Mfi,Ed reduziert |
|
| Der Nachweis wird über den elastischen oder plastischen Spannungsnachweis erbracht |
|
| Alternativ darf die Bemessung auf Temperaturebene durchgeführt werden
(EC 3-1-2, 4.2.4), indem die vorhandene Temperatur im Stahl θa der kritischen Temperatur θa,cr gegenübergestellt wird. |
|
| Die kritische Temperatur berechnet sich mit |
|
|
|
 |
|
| Die Schnittgrößenermittlung erfolgt auf Grundlage der Elastizitätstheorie. |
| Der Nachweis kann elastisch und plastisch geführt
werden. Der elastische Spannungsnachweis wird für einen dünnwandigen
Querschnitt geführt,
der plastische Spannungsnachweis wenn möglich nach EC 3-1-1, 6.2. |
| Für komplexere Querschnitte erfolgt der Spannungsnachweis
nach der Methode mit Dehnungsiteration. |
| Zusätzlich kann für dünnwandige Querschnitte der vereinfachte
Beulnachweis (c/t-Nachweis) in die Berechnung der Tragfähigkeit
einbezogen werden. |
|
| Der elastische Spannungsnachweis erfolgt
mit dem Fließkriterium
aus DIN EN 1993-1-1, 6.2.1(5) |
|
| Punktweise wird die Ausnutzung des Querschnitts berechnet mit |
|
| Die Berechnung der Normalspannungen erfolgt mit |
|
| wobei sich η, ζ auf das Hauptachsensystem beziehen. |
|
| Für Nachweise im Brandfall wird der Materialsicherheitsbeiwert γM,fi (anstelle
von γM0) verwendet. |
|
| Die Schubspannungen werden nach der dünnwandigen Theorie
ermittelt. |
|
| Der plastische Spannungsnachweis wird ganzheitlich
am Querschnitt betrachtet und für Normal- und Schubspannungen gemeinsam
durchgeführt. Die Querschnittsausnutzung wird über
Laststeigerung ermittelt. |
|
| Nach EC 3-1-1, 5.5, ist über die Klassifizierung der Querschnitte die Begrenzung der Beanspruchbarkeit und Rotationskapazität durch
lokales Beulen festzustellen. |
Querschnitte der Klassen 1 und 2 dürfen
plastisch und elastisch nachgewiesen werden, für Querschnitte in
Klasse 3 kann nur der elastische Nachweis geführt werden. Querschnitte
in Querschnittsklasse 4 sind beulgefährdet und müssen gesondert
untersucht werden. |
Die Querschnittsklassifizierung erfolgt nach dem c/t-Verhältnis der
druckbeanspruchten Querschnittsteile,
wobei c der Länge des Querschnittsteils
und t dessen Dicke entspricht. |
| Im Brandfall wird der Materialbeiwert abgemindert mit (s. EC 3-1-2, 4.2.2(1)) |
|
|
| Die Ausnutzung berechnet sich mit |
|
|
|
| Elastischer Nachweis für dünnwandige Querschnitte |
 |
|
|
Der elastische Nachweis kann für alle dünnwandigen Querschnitte durchgeführt
werden,
die entweder der pcae-Profiltafel entnommen, parametrisiert
eingegeben oder mit dem
pcae-Programm 4H-QUER als dünnwandiges
Profil erzeugt wurden. |
| Einen dünnwandigen Querschnitt kennzeichnet, dass seine Blechdicken
im Verhältnis zu ihrer Länge klein sind, sodass der Querschnitt über
Linien
modelliert werden kann. |
Jede Linie hat eine ggf. linear veränderliche
Dicke und kann Ausrundungen am Anfang und
Ende besitzen. |
|
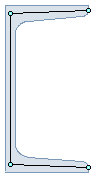 |
|
|
| Die Normalspannungen werden am polygonalen
Querschnitt berechnet, während die Schubspannungen
auf die Linien bezogen werden.
Demzufolge gilt für den Schubspannungsanteil der
Querkräfte,
dass die Schubspannungen
über die Dicke konstant verlaufen (hier: horizontale
bzw. vertikale Konturengrenzen), während der Anteil
aus Torsion sich linear über
die Dicke verändert. |
| Der Nachweis wird für die maximale Vergleichsspannung geführt. |
|
|
|
|
|
|
| Plastischer Nachweis nach EC 3-1-1, 6.2 |
 |
|
Der Nachweis folgt den Regeln des EC 3-1-1, 6.2.2 bis
6.2.10. Es wird der ungeschwächte Bruttoquerschnitt
zu Grunde
gelegt. |
| Der Querschnitt gehört den Klassen 1 oder 2 an. |
|
| Die plastische Normalkrafttragfähigkeit berechnet
sich mit (6.2.3+4) |
|
| Die plastische Biegetragfähigkeit berechnet sich
mit (6.2.5) |
|
| Die plastische Querkrafttragfähigkeit berechnet
sich mit (6.2.6) |
|
| Die plastische Torsionstragfähigkeit berechnet sich
mit (6.2.7) |
|
| Die plastische Berechnung basiert auf dem Nachweis der
Momentenbeanspruchbarkeit. Dazu wird die plastische Biegetragfähigkeit
in Abhängigkeit der anderen Beanspruchungen (N, V, T) abgemindert. |
| Bei kombinierter Beanspruchung aus Querkraft und Torsion
ergibt sich nach 6.2.7 |
|
| Die ggf. abgeminderte Querkraft wirkt sich nach 6.2.8
auf die Momententragfähigkeit aus, wenn gilt |
|
| Anstelle der Steifigkeit fy wird das plastische
Widerstandsmoment um den ρ-Anteil der querkraftbelasteten Querschnittsteile
reduziert. Dadurch ergibt sich die reduzierte plastische Biegetragfähigkeit
zu |
|
| Die gleichzeitige Wirkung einer Normalkraft ist nach
6.2.9 bei der Biegetragfähigkeit zu berücksichtigen, wenn
gilt |
|
| Die reduzierte Biegetragfähigkeit beträgt |
|
| wobei die Biegetragfähigkeit bereits durch Querkraft
und/oder Torsion abgemindert sein kann. |
| Ebenso kann die Normalkrafttragfähigkeit durch Querkraft
und/oder Torsion abgemindert sein, da die querkraftbeanspruchten Querschnittsteile
um den Faktor ρ reduziert werden. |
|
| Der Nachweis wird bei einachsiger Biegung mit Normalkraft
geführt mit |
|
| und bei zweiachsiger Biegung mit Normalkraft mit |
|
|
|
|
|
| Plastischer Nachweis nach der Methode mit Dehnungsiteration |
 |
|
Der Nachweis kann für alle dünnwandigen Querschnitte durchgeführt
werden, die entweder der pcae-Profiltafel entnommen, parametrisiert
eingegeben oder mit dem pcae-Programm 4H-QUER als dünnwandiges
Profil
erzeugt wurden. |
| Flach- und Rundstähle sind jedoch
ausgenommen. |
|
| Das Verfahren der Dehnungsiteration (DIV) wird in R. Kindmann, J. Frickel: Elastische und plastische
Querschnittstragfähigkeit (Kapitel 10.10) beschrieben. |
| Die
Schubspannungen aus Querkraft und Torsion der einzelnen
Querschnittsteile (Flansche, Stege, ...) werden aus
der elastischen Schubverteilung berechnet. Diese Schubspannungen
reduzieren
die zulässige Normalspannung der Teile. |
| Können die Schubspannungen nicht
aufgenommen werden, muss der maximale mögliche Lastfaktor reduziert
werden. |
| Die Schubspannungen werden bei Spannungsüberschreitungen nicht
umgelagert. |
| Durch Variation der Dehnungsebene und der
Verdrillungsableitung wird unter Berücksichtigung der reduzierten
zulässigen Normalspannungen ein Dehnungszustand gesucht, dessen
resultierende Schnittgrößen ein maximales Vielfaches der aufzunehmenden
Schnittgrößen sind. |
Dieser Grenzdehnungszustand darf für keinen
Querschnittspunkt die Bruchdehnung εu überschreiten
bzw. -εu unterschreiten. |
Falls der sich so ergebende maximale Lastfaktor evtl. nicht
mit dem für die Schubspannungen verwendeten
Lastfaktor übereinstimmt,
sind weitere Berechnungsschritte notwendig, bis die Lastfaktoren nahezu
gleich sind. |
| Die plastische Querschnittsausnutzung ist der Kehrwert des
maximalen Lastfaktors. |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| Das Programm weist die Brandschutztragfähigkeit für dünnwandige Querschnitte der Klassen
1 bis 3 nach. |
| Der Nachweis kann auf Traglast- und Temperaturebene geführt werden. |
| Nähere Informationen zu den Verfahren finden Sie hier. |
|
Anhand des Doppel-T-Profils (Querschnittsklasse 1) werden
im Folgenden die Unterschiede der
beiden Verfahren dargestellt (Bsp. 1). |
Anschließend wird die Berechnung von frei definierten
Querschnitten (s. 4H-QUER) der
Querschnittsklasse
3 vorgestellt (Bsp. 2). |
| Abschließend werden die Auswirkungen der Bekleidung mit
Brandschutzmaterial gezeigt (Bsp. 3). |
|
|
| Bsp. 1:
HE280M, S235, My,Ed = 272 kNm, tfi =
30 min, oben abgeschattet, ungeschützt |
|
Der Querschnitt wirkt als
Träger einer Stahlbetonplatte. Die Brandbeanspruchung
ist an den drei anderen Seiten
und bewirkt eine ungleichmäßige
Temperaturverteilung. Nach 30 min ergibt sich die Stahltemperatur Ta |
|
| Eine grafische Darstellung zeigt
die Temperaturentwicklung in Bezug zur Einheitstemperaturkurve. |
|
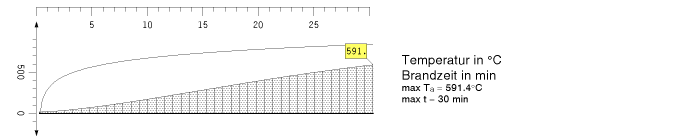 |
| Daraus ergeben sich die Materialkennwerte fy,fi,
Efi, αT,fi |
|
| Eine grafische Darstellung zeigt
die Spannungsdehnungslinie im Brandfall in Bezug zur Linie bei
Normaltemperatur. |
|
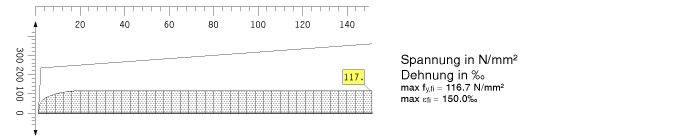 |
|
| Für die Bemessung mit dem einfachen Bemessungsverfahren
n. EC 3-1-2, 4.2 sind lediglich fy,fi und
Efi relevant. |
|
Es liege eine ungleichmäßige Temperaturverteilung
vor, so dass das einwirkende Moment für den
Spannungsnachweis
mit dem Faktor κ1·κ2 =
0.7 abgemindert werden darf auf |
|
Der Nachweis auf Traglastebene wird mit dem plastischen
Spannungsnachweis geführt und ergibt die
Ausnutzung Upl. |
|
| Mit dem c/t-Nachweis kann die Zulässigkeit des Verfahrens
(elastisch bzw. plastisch) überprüft werden. |
|
Für den Nachweis auf Temperaturebene ist
der Ausnutzungsgrad zum Zeitpunkt t = 0 (bei Normaltemperatur)
zu bestimmen. |
|
Ist der Nachweis erfüllt, kann die kritische Temperatur
Tcr bestimmt werden, mit der der Brandschutznachweis
geführt wird. |
|
|
|
| Bsp. 2:
U120 + L100x50x8, S275, tfi = 60 min, allseitig beflammt, ungedämmt |
|
| Die Profile sind rückseitig aneinander geschweißt. |
|
Der Querschnitt ist allseitig beflammt. Der den Flammen ausgesetzte
Umfang des Gesamtquerschnitts beträgt
Am = UU+UL-2·100 =
416.4 + 277.1 - 2·100 = 493.5 mm. Die Oberfläche des
umschließenden
Kastens für die Abschattungseffekte durch den Querschnitt
selbst beträgt Ab = Ub,U+Ub,L-2·100
= 350 + 261.8 - 2·100 = 411.8 mm. |
|
| Nach 60 min ergibt sich die Querschnittstemperatur Ta |
|
| Der Nachweis wird auf Temperaturebene geführt und ergibt
für die Schnittgrößen im Brandfall |
|
|
|
| Bsp. 3: IPE300, S235, tfi =
90 min, oben abgeschattet, gedämmt |
|
| Mit diesem Beispiel wird die Berechnung der Temperatur
eines brandgeschützten
Profils gezeigt. Der Querschnitt ist kastenförmig mit Faser-Zement-Platten
bekleidet und wird dreiseitig beflammt. |
|
| Nach 90 min ergibt sich die Stahltemperatur Ta |
|
|
|
|
 |
| zur Hauptseite 4H-EC3BN, Brandschutznachweis |
 |
|
 |